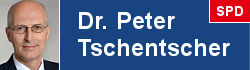Archiv
07.01.2010
Jahresschlussansprache des Präses der HANDELSKAMMER HAMBURG Frank Horch vor der Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e. V. am 31. Dezember 2009 in der Handelskammer Hamburg
 "Nicht die Politik ist das Schicksal, sondern die Wirtschaft."
"Nicht die Politik ist das Schicksal, sondern die Wirtschaft." An diesen Worten von Walther Rathenau mögen vielleicht manche zweifeln in einer Zeit, in der infolge der schwersten Welt-Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit Staatseingriffe in die Wirtschaft an der Tagesordnung sind. Rathenaus Aussage gilt gleichwohl, sonst wären diese Eingriffe schon in ihrem Umfang nicht gerechtfertigt gewesen. Nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts besagt die moderne politische Erkenntnis längst: Eine leistungsfähige Wirtschaft ist und bleibt Garant von Frieden im Inneren wie im Äußeren und ist Grundlage aller Bereiche der Lebensentfaltung.
Eine leistungsfähige Wirtschaft, die individuelle Chancen eröffnet und Frieden im Inneren wie im Äußeren erhält, muss sich jedoch an einem Regelwerk orientieren, das sowohl der ökonomischen Vernunft als auch ethischen Maßstäben gerecht wird.
Blicken wir zunächst auf die aktuelle weltwirtschaftliche Entwicklung, so ist festzustellen, dass viele Stimmungsindikatoren wieder nach oben weisen. Auftragseingänge und Produktion steigen, wenn auch auf niedrigem Niveau. Der Welthandel nimmt wieder leicht zu. Die Konjunkturforscher erwarten für 2010 ein Wirtschaftswachstum von weltweit gut 2 Prozent und einen Anstieg des realen Welthandels um gut 5 Prozent. Das sind gute Nachrichten! Kurzum: Die internationale Arbeitsteilung wird sich – wenn auch zunächst mit etwas gebremster Dynamik –, fortsetzen. Voraussetzung dafür sind nicht zuletzt funktionsfähige Weltfinanzmärkte, deren bisheriger Rahmen sich leider nicht als krisenverhindernd oder –dämpfend erwiesen hat.
Was ist zu tun? Zunächst geht es um die Wiederentdeckung des gesunden Menschenverstandes, das heißt: Keine unverantwortlichen Beleihungen über den Wert der Sache hinaus und kein gepriesener Verkauf von Anlageprodukten, um nicht zu sagen sogenannten Finanzinnovationen, die der verkaufende Banker selbst nicht versteht. Sofern die Finanzwirtschaft diesen Umstand nicht in den Griff bekommt, werden wir um einen TÜV für Finanzprodukte nicht umhinkommen. Dieser darf das Regulierungsdickicht nicht erhöhen, er muss sich aber gegebenenfalls der bislang regulierungsfreien Bereiche annehmen.
Dabei dürfen wir nicht übersehen, dass die Krise auch auf einem Versagen der staatlichen Aufsichtsinstrumente beruht. Die Finanzblase wurde nicht rechtzeitig erkannt, und die Aufsichtsinstrumente mussten durch beherztes Eingreifen der Bundesregierung übertrumpft werden.
Neben der Straffung der nationalen Aufsichtsstruktur, gerne unter Führung der unabhängigen Bundesbank, gilt es, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit effizient zu verzahnen. Der G20-Gipfel in Pittsburgh hat hierzu richtige Schritte vereinbart. Wir brauchen eine internationale Übereinkunft über Höhe und Natur der Eigenkapitalausstattung der Banken, ohne dass diese Vorschriften in ihrer Anwendung auf den Kreditmärkten krisenverschärfend wirken. Die Rating-Agenturen gehören auf den Prüfstand, und wir brauchen entsprechende Einrichtungen, die die europäischen Verhältnisse kennen. Das alles ist in die Zukunft gedacht. Einstweilen laborieren wir noch an den Wunden der Krise, die uns noch lange beschäftigen werden. Vor diesem Hintergrund hat sich in Hamburg unsere seit 2007 bestehende Initiative "Finanzplatz Hamburg" und die mit ihr geschaffene Vernetzung von Unternehmen und Politik als sehr hilfreich erwiesen.
Zur Stabilisierung des Finanzsystems leistet der Staat mit den Garantien zur Refinanzierung der Banken und zur Eigenkapitalstärkung Hilfe zur Selbsthilfe, ohne die betroffenen Akteure aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Angesichts der Milliardenbeträge, um die es dabei geht, kann ich den Unmut einer soliden Bank, eines im harten Wettbewerb stehenden Mittelständlers, das Unverständnis des Leiters eines kleinen Theaters, dem Kürzungen staatlicher Zuschüsse um einige zehntausend Euro drohen, oder das Gefühl der Ungerechtigkeit bei einem Rentner angesichts möglicher "Nullrunden" gut verstehen.
Dennoch: Es ging nicht darum, dem Finanzsektor Geschenke zu machen. Es ging und geht ausschließlich darum, unser wirtschaftliches System insgesamt zu sichern, zu dem es keine Alternative gibt. Die eingreifende Hand des Staates spielte und spielt als Brückenbauer aus der Krise eine wichtige Rolle. Mit der Rückkehr in normales wirtschaftliches Fahrwasser rückt die Frage nach Rückzugs-Strategien des Staates zunehmend ins Blickfeld. Denn richtig bleibt: Der Staat ist, wie das Beispiel einiger Landesbanken leider beweist, weder der bessere Banker noch der bessere Unternehmer. Eine zeitlich begrenzte staatliche Unterstützung oder eine Beteiligung an einem Unternehmen kann dann sinnvoll sein, wenn es eine gute Prognose im Wettbewerb hat und wenn systemische Bedeutung für einen Sektor oder einen ganzen Wirtschaftsstandort vorliegt. Was wir aber abwehren müssen, sind strukturerhaltende Maßnahmen und Staatshilfen für Firmen, die wegen fehlender nachhaltiger Perspektiven in Bedrängnis kommen. Der Staat darf nicht die Selbstheilungskräfte der Marktwirtschaft außer Kraft setzen. Das wäre das Ende von Markt- und der Einstieg in die Staatswirtschaft. Es bleibt daher dabei: Es gibt Risiken, die vom Unternehmer selbst getragen werden müssen. Wer Gewinne privatisiert und Verluste zu sozialisieren trachtet, der handelt nicht wie ein ehrbarer Kaufmann! Mehr denn je gilt, dass wirtschaftliche Freiheit zwingend moralischer Normen bedarf, damit mit ihr verantwortungsvoll umgegangen wird. Wenn Investmentbanker, die für tiefrote Zahlen verantwortlich sind, vor Gericht um Millionen-Sonderzahlungen streiten – und sie auch erhalten – kann ich die öffentliche Empörung gut nachvollziehen. Private Gewinnmaximierung einiger Manager ungeachtet ihres massiven Fehlverhaltens und ihrer zweifelhaften fachlichen Fähigkeiten sowie die ungebremste Subventionsmentalität einiger im Unternehmerlager haben das Vertrauen in die wirtschaftlichen Eliten erschüttert. Die Tatsache, dass einige Unternehmer beziehungsweise Manager gravierende Fehler gemacht haben, rechtfertigt aber nicht, das Unternehmertum in seiner Gesamtheit schlecht zu machen.
Ich betone deshalb genauso deutlich: Die überwältigende Zahl der Unternehmer geht ihren Geschäften verantwortlich nach, tut ihre Arbeit und leistet ihren Beitrag zur Beschäftigung und Wertschöpfung, ohne die die Gesellschaft einschließlich Kultur, Bildung und Sozialstaat nicht leben könnte. Unser Wohlstand beruht dabei weiterhin maßgeblich auf der internationalen Arbeitsteilung.
Unsere Handelskammer hat auch im zu Ende gehenden Jahr die außenwirtschaftliche Rolle unseres Standortes weiter intensiv gepflegt, – bei gemeinsamen Delegationen von Senat und Wirtschaft in die USA, Lateinamerika, Skandinavien und auf die arabische Halbinsel, durch Gespräche mit ausländischen Staatsgästen, Konsulaten und Geschäftspartnern und nicht zuletzt mit einer Vielzahl außenwirtschaftlicher Veranstaltungen.
Dabei haben wir auch immer wieder deutlich gemacht, dass der freie Welthandel mehr Wohlstand schafft, als es eine geschlossene Volkswirtschaft allein für ihre Bürger je könnte. Einem Bericht der EU-Kommission zufolge haben allerdings die Haupthandelspartner der EU allein zwischen Herbst 2008 und Herbst 2009 über 220 neue Handelshemmnisse geschaffen. Der aufkeimende Protektionismus ist daher eine große Gefahr, der wir gegenwärtig gegenüberstehen. Der Rückzug auf nationales Terrain ist keine Lösung. Was wir brauchen, das ist ein fairer Freihandel auf der Basis eines neuen Welthandelsabkommens.
Zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung gehört auch ein globaler Klimaschutz, in den zwingend alle Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer wirksam einbezogen werden. Der nach allem, was man lesen kann, nicht sehr professionell abgelaufene Kopenhagener Klimagipfel hat die Welt auf diesem Weg so gut wie keinen Schritt vorangebracht. Die sehr rasch voranschreitende Veränderung des Weltklimas mit großen Betroffenheiten zahlreicher Länder lässt uns aber keine Zeit für Schuldzuweisungen. Auch Alleingänge nützen dem Weltklima gar nichts. Bei einem Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß von 3 Prozent für Deutschland und 14 Prozent für die EU wären auch die ehrgeizigsten Alleingänge ökologisch ohne allzu großen Belang. Ökonomisch hätte es für Wachstum und Beschäftigung hierzulande aber erhebliche negative Wirkungen.
Deshalb bleibt eine konzertierte Aktion das Gebot der Stunde. Und deshalb ist nach dem Gipfel vor dem Gipfel. Hierzu muss weiter Überzeugungsarbeit, zum Beispiel in den USA und in China, geleistet werden. Zugleich dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, dass auch die Entwicklungsländer das Recht auf Entwicklung und, das heißt, ein Recht auf Emissionen haben. Wir müssen ihnen helfen, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass Wachstum und Klimaschutz auch dort vereinbar sind. Das ist eine Frage von Bewusstseinsbildung und der konkreten Qualifikation der wirtschaftenden Menschen.
Für eine solche Entwicklungspolitik steht auch das Madagaskar-Projekt unserer Handelskammer, mit dem wir dort das System der dualen Berufsausbildung eingeführt haben und weiter ausbauen. Dieses Projekt ist auf dem diesjährigen Weltkongress der Internationalen Handelskammer in Kuala Lumpur als weltbestes Kammerprojekt ausgezeichnet worden. Ich denke, darauf können wir zu Recht ein gutes Stück stolz sein! Ebenso wie die Klima- und Entwicklungspolitik verlangen unsere Aufmerksamkeit die Konfliktfelder im Nahen Osten, am Horn von Afrika, im Iran und im Irak, der Kampf gegen den Terrorismus und die kriegerischen Auseinandersetzungen in Afghanistan, wo unsere Soldaten Anspruch auf situationstaugliche Einsatzregeln haben. Sonst handeln wir unverantwortlich und gefährden am Ende die gesellschaftliche Akzeptanz dieses Einsatzes. Auch 60 Jahre nach ihrer Gründung bleibt die NATO wesentlicher Eckpfeiler unserer gemeinsamen Sicherheit in der transatlantischen Gemeinschaft, die durch die inzwischen wieder mehr multilaterale Politik der Vereinigten Staaten eher gestärkt wird. Für Europa bedeutet dies aber auch, mehr weltpolitische Verantwortung zu übernehmen. Mit dem Lissabon-Vertrag verbessert die Europäische Union auch hier ihre Handlungsfähigkeit. Bessere Strukturen allein aber sind – wie wir wissen – noch kein Garant dafür, dass Europas Politiker auch den Willen zu einheitlichem Handeln aufbringen. Es bleibt abzuwarten, wie Europas erster Ratspräsident und Europas erste Außenministerin – auch wenn sie nicht so heißen darf – dazu beitragen, dass der Kontinent als einig handelnder Akteur in der Weltpolitik wahrgenommen wird. Dabei möge sich die Engländerin Catherine Ashton als mustergültige Europäerin erweisen. Wie sagte doch der britische Botschafter in Deutschland, Sir Michael Anthony Arthur, bei seiner Rede anlässlich der letzten Hamburger Morgensprache: "Die Engländer sind auch Europäer, aber sie haben sehr eigene Vorstellungen darüber, was das für sie bedeutet."
Und dies gilt nicht nur für die Engländer, wie wir aus dem Ratifizierungsprozess des Lissabon-Vertrages wissen. Ich freue mich, dass Hamburg künftig mit drei Abgeordneten im neuen Europäischen Parlament vertreten sein wird, mit denen wir eine enge Zusammenarbeit pflegen wollen. Unser Wirtschaftsstandort braucht gerade in Brüssel und Straßburg eine starke Stimme. Denn in den für Hamburg wichtigen Bereichen wie Hafen, Verkehr und Außenhandel wird Wirtschaftspolitik maßgeblich vom Europäischen Parlament gestaltet.
Zu einem Stück europäischer Identität ist für uns in den letzten 10 Jahren der Euro geworden. Er hat sich auch und gerade in der aktuellen Wirtschaftskrise als Stabilitätsanker erwiesen und strahlt eine Stärke aus, die es bei 16 verschiedenen Währungen mit ihrer Spekulationsanfälligkeit nicht gegeben hätte. Der Euro hat in der Krise seine Feuertaufe bestanden. Zugleich sieht er sich jetzt einer Reihe von Schwelbränden gegenüber.
Die Mitgliedstaaten der Eurozone haben alle ihre Neuverschuldung drastisch angehoben und liegen ausnahmslos mehr oder weniger deutlich oberhalb der Referenzwerte, die der Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgibt. Nun mögen außergewöhnliche Umstände wie die derzeitige Krise manche außergewöhnliche Maßnahme rechtfertigen. Die Haushaltsmisere Griechenlands allerdings ist im Kern eben nicht Folge der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung, sondern Ausdruck eines langjährigen Mangels an fiskalpolitischer Disziplin.
Unverändert gilt: Der Stabilitätspakt darf nicht aufgegeben werden. Die nachhaltige Bewältigung der Krise erfordert es, bei sich erholender Konjunktur die geldpolitischen Zügel wieder anzuziehen und die Maastricht-Kriterien mit der notwendigen Konsequenz anzuwenden. Entsprechend steht die Europäische Zentralbank mit ihrer Geldpolitik vor der Aufgabe, mit Blick auf das bestehende Inflationspotenzial rechtzeitig den Hebel umzulegen und zu finanzpolitischer Normalität zurückzukehren. Sie wird dabei auf Kritik stoßen: Zum einen, weil eine Lockerung der Geldpolitik immer auf deutlich größere Zustimmung stößt als umgekehrt.
Zum anderen, weil der wirtschaftliche Aufschwung nicht in allen Ländern der Euro-Zone gleichmäßig verlaufen wird. Der Unabhängigkeit der europäischen Zentralbanker muss deshalb unsere volle Unterstützung gehören, denn Geldwertstabilität, meine Damen und Herren, ist nicht verhandelbar! Für das kommende Jahr ist in Deutschland mit einem bescheidenen Wirtschaftswachstum von knapp eineinhalb Prozent zu rechnen. Dem steht allerdings ein bislang beispielloser Rückgang in 2009 von rund 5 Prozent gegenüber. Deshalb muss weiterhin mit erheblichen Auswirkungen auf die Beschäftigung gerechnet werden. Die Unterkühlung der deutschen Konjunktur ist für viele nicht mehr lebensbedrohlich, doch auf eine normale Temperatur hat sich das Konjunkturthermometer in Deutschland noch längst nicht wieder eingependelt.
Besorgnis erregend ist, dass die Unternehmensfinanzierung vor dem Hintergrund schwacher Bilanzen des Krisenjahres 2009 im Jahr 2010 unter schwierigen Vorzeichen stehen wird. Darauf deuten auch unsere Umfragen hin. Wir müssen daher sicherstellen, dass der wachsende Optimismus von ausreichenden Finanzierungsmitteln begleitet wird. Das Angebot der Banken auf dem kürzlichen Konjunkturgipfel im Bundeskanzleramt, hierzu gerade für die mittelständische Wirtschaft einen Fonds aufzulegen, begrüße ich sehr.
Gerade auch Fragen der Finanzierung sind Teil des zusätzlichen Dienstleistungsangebots unserer Handelskammer, mit dem wir unseren Unternehmen mit Beratung, Vermittlung und Information helfen wollen, die Krise zu bewältigen. Projektmittel aus dem Europäischen Sozialfonds werden uns dabei helfen.
"Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen", so befand einst Hermann Hesse.
Von Angela Merkel stammt dagegen das Wort: "Mit dem Kopf durch die Wand geht nicht. Da siegt zum Schluss immer die Wand."
Deren Geometrie wird seit der Bundestagswahl neu vermessen. Ich denke, es spricht einiges dafür, die zur Stärkung der Wachstumskräfte in Deutschland notwendigen Schritte zwar entschlossen und nachhaltig, zugleich aber unter Wahrung der sozialen Balance anzugehen, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu sichern. Dazu gehört für mich auch, dass ein kommender Aufschwung alle erreicht!
Eine steuerliche Entlastung der Familien mit Augenmaß, eine wirksame Reform des Gesundheitswesens zur Dämpfung der Lohnzusatzkosten und mittelstandspolitisch gebotene Korrekturen der Unternehmen- und Erbschaftsteuerreform – das alles sind Maßnahmen, mit denen unser Land aus der aktuellen Krise herauswachsen und Wachstums- und Beschäftigungschancen der Zukunft ergreifen kann. Das ist es, worauf es ankommt! Das vor Weihnachten verabschiedete Wachstumsbeschleunigungsgesetz ist daher ein erster wichtiger Schritt, mit dem unter Begleitung von viel Theaterdonner die neue Bundesregierung Handlungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit beweist. Gradmesser für die Bewertung der Regierung wird letztlich sein, ob sie ihre im Koalitionsvertrag niedergelegten Absichten in den kommenden Jahren mit guten Ergebnissen krönt. Mut beweist die Regierung mit ihrem Ansatz, den schwierigen Spagat zwischen Steuerentlastung und Haushaltskonsolidierung zu bewältigen.
In Zeiten rekordhoher Staatsverschuldung die Löcher in den öffentlichen Kassen nicht durch Steuererhöhungen, sondern mit mehr Wachstum durch steuerliche Entlastungen zu stopfen, ist eine Gratwanderung nicht ohne Risiko. Aber, meine Damen und Herren, eine nachhaltige Konsolidierung wird es nicht geben können ohne Wachstum. Nachhaltiges Wachstum ist aber mit geringer Steuerbelastung eher wahrscheinlich als mit hoher! Zu einer grundlegenden Steuerreform gehört für mich vor allem die Vereinfachung unseres Steuersystems. Der geplante Umbau des Steuertarifs zu einem Stufentarif – insbesondere von der FDP und unserem früheren Wirtschaftssenator und Bundestagsabgeordneten Uldall verfochten – wäre dazu ein wichtiger Beitrag. Ein Stufentarif entschärft den sogenannten Mittelstandsbauch und bietet einen hervorragenden Ansatz zur Beseitigung der "kalten Progression". Dazu müsste der Stufentarif nur regelmäßig der Inflationsrate angepasst werden. So würde verhindert, dass die Steuerbelastung für den Einzelnen schon allein aufgrund der Geldentwertung zunimmt. Im übrigen wäre es auch ein taugliches Instrument, die Staatsquote unter Kontrolle zu halten.
Unsere weitsichtigen Hamburger Volksvertreter in Berlin werden sich diesen Vorschlag sicher sofort zu eigen machen! Oder?
Michelangelo wurde einst gefragt, wie er seinen wunderbaren David habe schaffen können. Er hat geantwortet: "Ich habe nur das Zuviel an Marmor weggenommen." Ein schöner Gedanke! Unser Staat sieht dagegen eher aus wie Goliath oder ein David, der durch ein Zuviel an Normen und Regeln zuviel unnötiges Gewicht auf die Waage bringt.
Was die erforderliche Reduzierung der Bürokratiekosten betrifft, so stimmen mich die Absichten der Koalition zuversichtlich. Die Bundesregierung bekennt sich eindeutig dazu, die Kostenbelastung der Wirtschaft durch Informationspflichten, die sich auf rund 50 Milliarden Euro im Jahr belaufen, bis 2011 per saldo um 25 Prozent zu reduzieren. Bürokratieabbau ist wie ein Wachstumsprogramm zum Nulltarif! Bestärken wir die Regierenden darin, diese Wachstumschance zu nutzen! Notwendig ist auch eine unbürokratische Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in Bezug auf die Einrichtung des sogenannten Einheitlichen Ansprechpartners. Er soll Gründer und Unternehmen aus ganz Europa vor Ort bei der Unternehmensgründung und Genehmigungserfordernissen unterstützen.
Die Rolle dieses One-Stop-Shops übernimmt in Hamburg unsere Handelskammer im Verbund insbesondere mit der Handwerkskammer. Dies sorgt für größere Sachnähe als wenn diese Aufgabe bei einer staatlichen Stelle verortet worden wäre. Unsere Handelskammer freut sich auf diese Aufgabe, und wir werden alles tun, sie effizient, praxisnah und kostengünstig zu erfüllen. Ich danke Ihnen, Herr Bürgermeister von Beust, dass Sie diese Chance zur Verwaltungsvereinfachung und Kundenorientierung ergriffen und durchgesetzt haben.
Unsere Wirtschaft braucht eine Energieversorgung, die Versorgungssicherheit bietet, zu wettbewerbsfähigen Preisen verfügbar und zugleich klimaschützend ist. Dabei stellen die fossilen Energieträger und die Kernenergie aus meiner Sicht zur Zeit unverzichtbare Überbrückungstechnologien dar, bis die Frage der Speicherfähigkeit der erneuerbaren Energien so effektiv gelöst ist, dass deren Anteil im Energiemix weiter erhöht werden kann. Bis dahin werden wir auch um eine Lösung der Endlagerproblematik nicht umhinkommen. Mit den Aktivitäten der Wasserstoffgesellschaft in Hamburg, die in diesem Jahr ihr 20jähriges Bestehen feiern konnte, fördern wir die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, die einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der Speicherproblematik bei den erneuerbaren Energien leisten kann.
Mit den erneuerbaren Energien sind große Wachstumschancen für den Wirtschaftsstandort Norddeutschland verbunden.
Als Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Industrie- und Handelskammern, kurz IHK Nord, fordern wir deshalb, den land- und seeseitigen Anschluss der geplanten Offshore- Windenergieparks sicherzustellen, notwendige Netzkapazitäten auszubauen und die für die Logistik erforderliche Infrastruktur in den norddeutschen Häfen zu schaffen. Dies muss einfließen in einen "Masterplan Energie", den vorzulegen die Bundesregierung angekündigt hat.
Wenden wir unseren Blick der Stimmung in der Hamburger Wirtschaft zu, so belegen die Ergebnisse der Konjunkturumfragen unserer Handelskammer eine Verbesserung. Die Investitions- und Personalpläne sind aber nach wie vor sehr zurückhaltend. Auch in Hamburg müssen wir daher mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit rechnen, obwohl sich der Arbeitsmarkt derzeit noch relativ robust zeigt. Daran hat natürlich die Kurzarbeit ihren Anteil. Ich denke aber, dass unsere Unternehmen mit dem Thema Personalabbau insgesamt sehr verantwortlich umgehen. Das geschieht sicher auch im wohlverstandenen eigenen Interesse, um Fachkräfte im Unternehmen zu halten.
Die Konjunkturpakete des Bundes und Hamburgs haben die Entwicklung zu einem Gutteil stabilisiert, wobei diese Maßnahmen sich vor allem im kommenden Jahr auswirken werden. Beim Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in unserer Stadt stehen vor allem die maritime Wirtschaft und unser Hafen vor großen Herausforderungen. So liegt der Gesamtumschlag 2009 um rund 23 Prozent, der Containerumschlag um knapp 30 Prozent unter dem Vorjahr. Dabei fiel dieser Umschlagsrückgang höher aus als in den Konkurrenzhäfen wie Rotterdam, Antwerpen oder Zeebrügge. Um so wichtiger ist es, unsere Rolle als Welthafen mit zentraler Bedeutung für Mittel- und Osteuropa sowie für die Ostseeregion zu verteidigen und bei einem verschärften Wettbewerbs- und Kostendruck die Grundlage für künftiges Wachstum zu schaffen. Ich begrüße daher das Preissignal, das alle an den Hafenanlaufkosten beteiligten Akteure – von der Hamburg Port Authority über die Lotsen bis hin zu allen Hafendienstleistern – vor wenigen Wochen in die Märkte ausgesendet haben. Diese konzertierte Aktion hat bewiesen, dass unser Hafen gerade in Zeiten der Krise Einigkeit und Handlungsfähigkeit beweist. Ich beglückwünsche Sie, Herr Senator Gedaschko, zu diesem Erfolg, zu dem selbstverständlich viele beigetragen haben, nicht zuletzt auch etwas unsere Handelskammer.
Ähnliches gilt für den gemeinsam errungenen Durchbruch in der Frage der Auflösung der Freizone im Hafen, unter der Bedingung, dass künftig der Zoll zu den Kunden kommt.
Zur Zukunftssicherung des Hafens muss die zügige Umsetzung der Fahrrinnenanpassung der Unterelbe oberste politische Priorität erhalten. Auch der Bundesverkehrsminister hat jüngst zum Ausdruck gebracht, dass es sich dabei um eine Angelegenheit von nationaler Bedeutung handelt. Ich wiederhole es daher noch einmal vor dieser Versammlung: Die bei der Fahrrinnenanpassung eingetretene Verzögerung bis zum Jahr 2011 muss das letzte Wort in dieser Sache sein!
Ich begrüße es, dass in der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung vereinbart wurde, neben der seeseitigen auch die landseitige Erreichbarkeit der deutschen Seehäfen zu stärken.
Dazu gehört für uns insbesondere der Bau der Hafenquerspange und der Y-Trasse im Schienenverkehr. Ihre Finanzierung muss sichergestellt und sie müssen zügig realisiert werden. Wir haben in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, bis zu 30 Prozent der Verkehrswegeinvestitionen aus der Verteilung nach Länderquoten herauszunehmen und schwerpunktmäßig für Verkehrsprojekte von nationaler Bedeutung einzusetzen.
In Hamburg selbst halten wir erfreulicherweise daran fest, den Ausbau des Hafens fortzusetzen, wobei unsere Rolle als Universalhafen zunehmend in den Mittelpunkt rückt. Wir sind klug beraten, die Wachstumspause zu nutzen, um Investitionsrückstände aufzuholen.
Eine tragende Säule der Hamburger Wirtschaft ist auch die Industrie, die mit ihren Produkten vielfach Ausgangspunkt für Handel, Logistik und Dienstleistungen ist. Industriebetriebe bilden einen wichtigen Teil der stark wachsenden Gesundheitswirtschaft, deren Teilnahme am Wettbewerb "Gesundheitsregion der Zukunft" die Zusammenarbeit aller Akteure stark vorangebracht hat. Die Gründung der gemeinsam durch Senat und Wirtschaft getragenen "Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH" steht für das Erfolgskonzept Public-Private-Partnership.
Aber auch in den Clustern Life Science, Luftfahrt, Logistik und Medienwirtschaft wird wertvolle Arbeit geleistet. Aber vergessen wir nicht: Die Mehrzahl der Unternehmen lässt sich keinem dieser Cluster zuordnen. Auch sie verdienen besonders die Fürsorge unserer Wirtschaftspolitik.
Zur Stärkung des Einzelhandels, der sich bislang als erfreulich stabiler Faktor der Konjunktur erweist, hat das Instrument des "Business Improvement District" bislang erheblich beigetragen. In Hamburg gibt es derzeit sechs sogenannte BIDs, in denen Grundeigentümer gemeinsam in die Gestaltung des öffentlichen Raums investieren, um im Ergebnis die Standortqualität zu verbessern. Weitere sind in Vorbereitung. Das bisher größte seiner Art in Europa wird das rund 15 Hektar große BID Nikolaiquartier sein, mit dem wir die öffentlichen Räume und Plätze in dem Quartier, in dem sich einst die Wiege Hamburgs als Kaufmannstadt befand, in mehreren Bauabschnitten bis 2014 komplett in neuem Glanz erstrahlen lassen wollen.
Kritisch sehen Einzelhändler, die Gastronomie und die Hotellerie das Ausbremsen etablierter Großevents von hoher wirtschaftlicher Wertschöpfung, wie den Harley Days oder dem Schlagermove, sowie die Diskussion um Umweltzone und City-Maut. Der Nutzen einer Umweltzone für die Verbesserung der Luftqualität ist – wie wir aus zahlreichen Studien wissen – äußerst begrenzt. Sie ist, wie unsere Analyse gezeigt hat, wahrscheinlich kein geeignetes Instrument zur Lösung eines Problems, welches Hamburg dank sauberer Luft weitestgehend nicht hat.
Die Einschränkung der Erreichbarkeit der Innenstadt durch Umweltzone oder City-Maut würde aber die Attraktivität der Innenstadt erheblich schwächen und nachweisbar zu Umsatzrückgängen führen, denn ein hoher Anteil unserer Innenstadtkunden kommt aus der Region. Von unserer attraktiven City profitiert nicht zuletzt die Tourismusbranche, die erfreulicherweise die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre fortsetzt. Mit über 5 Prozent mehr Übernachtungen verzeichnet Hamburg das stärkste Wachstum im Vergleich der europäischen Städtedestinationen.
Ich rufe deshalb den Senat zum Verzicht auf eine Umweltzone auf und schlage stattdessen erneut eine "Partnerschaft für Luftgüte und schadstoffarme Mobilität" nach dem Vorbild der erfolgreichen Umwelt-Partnerschaft vor, in der sich die Wirtschaft für den Einsatz neuer, emissionsfreier Antriebe im Straßenverkehr und die weitere Stärkung des ÖPNV in Hamburg einsetzen wird. Ob dazu allerdings die Stadtbahn der ideale Schritt ist, daran sind bis zur planungsgemäßen Vorlage der Nutzen-/Kostenanalyse in eineinhalb Jahren Fragen erlaubt. Ist die Weiterführung der U4 nach Süden und der Ausbau der S4 nach Ahrensburg nicht mindestens so wichtig? Bedarf es neben U-Bahn und S-Bahn wirklich eines dritten trassengeführten ÖPNV-Systems? Und sind für eine Millionenstadt – wie verlautbart – Freiburg und Straßburg wirklich geeignete Benchmarks? Sicher alles schöne Städte mit schöner Straßenbahn. Aber soweit ich weiß, haben weder Straßburg noch Freiburg ein UBahn- oder ein S-Bahn-System.
Nicht zuletzt die Vorgänge im Gängeviertel und um die IKEA-Ansiedlung in der Großen Bergstraße haben eine Diskussion über die Rolle von Künstlern und Kulturszene für die Stadt- und Standortentwicklung ausgelöst. Unbestritten haben Künstler, Kreative und zum Teil auch Subkultur nicht nur eine Treiberfunktion für die sogenannte Kreativwirtschaft, sie sind hin und wieder auch Teil erfolgreicher Stadtentwicklung. Dieses kreative Milieu mit einem gezielten Immobilienangebot durch die neu gegründete Kreativagentur zu unterstützen, möchte ich deshalb durchaus befürworten. Ich setze dabei voraus, dass die Szene selbst nicht beabsichtigt, durch subventionierte Dauermietverträge zu einem Cluster von "Staatskünstlern" zu mutieren. Auf der anderen Seite treiben gerade Investoren die Entwicklung unserer Stadt voran, machen sie an vielen Stellen attraktiver und stiften neben privatem auch öffentlichen Nutzen. Während das Gängeviertel es durchaus verdient, als historischer Gebäudekomplex in seiner Struktur erhalten zu werden, ist der Abriss des Frappant-Gebäudes in der Großen Bergstraße nun wirklich kein Verlust. Im Gegenteil: Die nachfolgende Ansiedlung von IKEA ist sowohl architektonisch wie auch stadtentwicklungspolitisch ein großer Schritt nach vorn, der lang ersehnte Perspektiven für den ganzen Stadtteil eröffnet. Auch für die Stadtentwicklung gilt: Es gibt kein Grundrecht auf Stillstand!
Nicht zuletzt geht es bei diesem Thema um das Ansehen Hamburgs als Investitionsstandort. Zu dessen Anziehungskraft gehört selbstverständlich ein reiches kulturelles Leben. So wie wir Kulturstadt sind und bleiben, wollen wir auch Stadt für Spitzen- und Breitensport sein. Hier darf die Stadt nicht wanken! Mit unserer Hamburger SportlerBörse fördern wir die Vermittlung von Leistungssportlern in Ausbildung und Beruf. So helfen wir ihnen dabei, Beruf und Sport unter einen Hut zu bringen.
Unter einem Hut bewegt sich auch die Schwarz-grüne Koalition in Hamburg. Was zunächst wie eine aus dem Wahlergebnis erwachsene Vernunftehe erschien, erwies sich schon sehr früh als Partnerschaft, die bislang von hoher, ja fast unheimlicher Harmonie geprägt ist. Wir waren heute sogar kurz davor, die Sitzordnung dieser 188 Jahre alten Veranstaltung zu ändern und den Ersten Bürgermeister und die Zweite Bürgermeisterin unmittelbar nebeneinander zu setzen. Ich denke jedoch, für diese Stunde wird es auch so gehen.
Das Bündnis hat sich in der ersten Halbzeit der Legislaturperiode stabil und professionell gezeigt. Das wünsche ich mir auch für die zweite Hälfte. Aber noch mehr wünsche ich mir richtige Entscheidungen bei den standortpolitischen Weichenstellungen, die anstehen. "Einmal geht es sicherlich darum, auch gerade jetzt wirtschaftlich und investiv die Grundlagen dafür zu sichern, dass wir dann, wenn es bergauf geht, auch wieder ganz vorne mit dabei sind. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht die Hände in den Schoß legen und erst, wenn es wieder losgeht, entscheiden, was zu tun ist." Dies hätten meine Worte sein können. Es waren aber Ihre, sehr geehrter Herr Bürgermeister von Beust, die Sie anlässlich des diesjährigen Überseetages gesprochen haben. Und ich füge hinzu: Bleiben Sie dabei! Mit dem Leitbild der Wachsenden Stadt war die Aufbruchstimmung geweckt und die Wachstumsstrategie vorgegeben, die uns in den vergangenen Jahren als Standort so nach vorn gebracht hat. Der Hinweis sei erlaubt, dass dieses Leitbild neben steigender Wertschöpfung und zunehmender Einwohnerzahl auch Lebensqualität und ökologische Zielsetzungen mit einbezog.
So wären wir froh, dieses Leitbild unter dem Motto "Hamburg. Wachsen mit Weitsicht" wiederzufinden. Dass man mit möglichst viel Weitsicht plant, ist für jeden hanseatischen Kaufmann eine Selbstverständlichkeit. Doch allen Ankündigungen zum Trotz harrt das Leitbild seither der konkreten Ausfüllung. So droht der Elan langsam zu versiegen, stattdessen braucht er neue Anschübe. Dies wird – aus meiner Sicht – die große Aufgabe der zweiten Hälfte der Legislaturperiode sein. Lassen Sie mich deshalb auf einige Gebiete eingehen, die für die Zukunftssicherung des Standortes von zentraler Bedeutung sind. Dabei geht es
- erstens um die finanzielle Handlungsfähigkeit Hamburgs,
- zweitens um notwendige Weichenstellungen in Bildung, Wissenschaft und Forschung
-
drittens um ausreichende Bereitstellung von Infrastruktur.
Meine Damen und Herren, die Wirtschaftspolitik von morgen wird maßgeblich durch die Finanzpolitik bestimmt, aber auch durch die Schulpolitik von heute. Um diese zu beurteilen, können wir seit einigen Monaten erfreulicherweise auf den langersehnten ersten Bericht der von uns über Jahre geforderten Schulinspektion zurückgreifen. Dort heißt es wörtlich: "Rund 90 Prozent der festgestellten Qualitätsunterschiede des Unterrichts liegen innerhalb der jeweiligen Einzelschule. Nur rund fünf Prozent der Qualitätsunterschiede lassen sich auf die Schulform zurückführen. Unterricht kann entsprechend an jeder einzelnen Schule sehr gut gelingen, jedoch auch misslingen – unabhängig davon, ob es sich um Haupt- und Realschule, Gesamtschule oder Gymnasium handelt." Fragt man sich, wie dies möglich ist, so liest man zwei Seiten weiter: "So finden regelmäßige Unterrichtsbesuche durch die Schulleitung mit dem Ziel der Qualitätskontrolle eher selten statt." Ende des Zitats.
Damit wird nun schwarz auf weiß und zudem amtlich bestätigt, dass über den Bildungserfolg für das einzelne Kind weniger die Schulform entscheidet – diese Diskussion führt in eine Sackgasse –, sondern – und das ist das eigentliche Thema! – die Qualität im Klassenzimmer! Um diese zu verbessern, wäre der konsequente Ausbau des schulischen Qualitätsmanagements erforderlich. Das hieße zum Beispiel mehr Binnendifferenzierung, schulinternes Benchmarking, Ausbau des internen Beurteilungswesens und der Inspektionsdichte.
Eingedenk der ausgestreckten Hand des SPD-Landesvorsitzenden Scholz würde ich mir wünschen, wenn die derzeitigen Verhandlungspartner unter Anleitung der vortrefflich ausgewählten Moderation von Herrn Dr. Michael Otto dieses Thema der Qualität ins Zentrum einer Einigung stellten, die einen längerfristigen Schulfrieden schafft. Künftige Reformen können dabei gar nicht behutsam genug angegangen werden, insbesondere benötigen sie genügend Zeit und keinesfalls ein "zuviel auf einmal".
Gerade bei der Frage der Primarschule bedarf es eines Aufeinanderzugehens statt eines Alles-oder-Nichts auf beiden Seiten. Im Kern geht es doch um die Frage: Wie sollen das 5. und 6. Schuljahr aussehen und wer hat Einfluss darauf? Frau Senatorin Goetsch, wenn Sie es mit der Individualisierung des Unterrichts ernst meinen, dann werden Sie auch und gerade in diesen Klassenstufen musische, humanistische und andere Profilbildungen ermöglichen wollen und dann kann es nur gut sein, wenn die weiterführenden Schulen darüber mitbestimmen dürfen. Eine Schule, die diese Bedingungen erfüllt, können Sie gerne Primarschule nennen.
Auch über den Erfolg von Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder aus bildungsfernen Elternhäusern entscheidet nicht die Überschrift über dem Schulgebäude. Wo die Elternhäuser nicht unterstützen können, da hilft nur die echte Ganztagsschule. Damit meine ich nicht die teilweise improvisierte Ganztagsschule von heute, sondern die mit geregeltem Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung. Wir würden damit übrigens auch etwas tun für die so notwendige Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Insbesondere auch höherqualifizierten Frauen wird nur so die Vereinbarung von Kind und Karriere zu ermöglichen sein. Ich fasse in vier Punkten zusammen, wovon ich mir Schulfrieden erhoffe:
Erstens: Klare Fokussierung auf die Qualität im Klassenzimmer durch Lehrerfortbildung, Beurteilungswesen, höhere Inspektionsdichte, Benchmarking.
Zweitens: Mehr Zeit für den organisatorischen Wandel – Veränderungen dürfen nur dort stattfinden, wo alle Vorbereitungen abgeschlossen sind.
Drittens: Die weiterführenden Schulen sollten die Inhalte der Klassenstufen 5 und 6 mitbestimmen und mitgestalten dürfen, um individualisierten Unterricht und Profilbildungen zu ermöglichen, die später fortgesetzt werden können.
Viertens: Durch mehr echte Ganztagsschulen entwickeln wir unser Gesellschaftssystem zukunftsgerecht – sowohl aus Sicht der Migranten wie auch aus Sicht all derer, die Beruf, Karriere und Familie vereinbaren wollen.
Das Ergebnis dieser Bemühungen wäre dann nicht die etwas missverständliche "eine Schule für alle". Das Ergebnis wäre vielmehr: Selbst wenn sie unter einem Dach stattfindet, die richtige Schule für jeden!
Von der Schule führt der Weg häufig in die Ausbildung. Unter den aktuellen konjunkturellen Bedingungen freue ich mich besonders, dass es in 2009 wiederum gelungen ist, in punkto Ausbildungsplätze ein ganz hervorragendes Ergebnis zu erzielen. Mit 9.354 neu eingetragenen Ausbildungsverträgen haben wir zum dritten Mal hintereinander die Hürde von 9.000 neuen Ausbildungsverträgen übersprungen. Die Hamburger Wirtschaft hat damit auch 2009 jedem ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen ein Angebot auf einen Ausbildungsplatz oder auf einen Platz im Rahmen der Einstiegsqualifizierung machen können. Mein herzlicher Dank gilt deshalb den ausbildenden Unternehmen für ihr Engagement!
Im kommenden Jahr erwarten wir gleich zwei Abiturjahrgänge, die auf die Hochschulen und den Ausbildungsmarkt zusteuern. Im Bereich der dualen Ausbildung wird dies voraussichtlich zu rund 1.300 zusätzlichen Bewerbern führen. Im Aktionsbündnis Bildung und Beschäftigung haben alle Kammern gemeinsam mit dem Senat, den Gewerkschaften und der Agentur für Arbeit vereinbart, zusätzlich 1.300 Ausbildungsplätze einzuwerben. Mit unserer Kampagne "Hamburg freut sich doppelt" ermutigen wir unsere Betriebe, verstärkt auszubilden, um die Fachkräfte für die kommenden Jahre zu gewinnen. Viele Unternehmen haben diese Chance bereits für sich erkannt und angekündigt, die Zahl ihrer Ausbildungsplätze aufzustocken. Ich appelliere an Sie: Wenn Sie es nicht schon getan haben, folgen Sie bitte diesem Beispiel!
Ein attraktives Angebot an Seminaren und Lehrgängen der berufsbezogenen Weiterbildung stellt unser Weiterbildungsunternehmen, die Handelskammer Bildungsservice Gesellschaft, kurz HKBiS, zur Verfügung, die in diesem Jahr auf 10 Jahre erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken kann.
Neben guter Schule und guter beruflicher Bildung braucht Hamburg eine exzellente Universität. Zu meinem Bedauern ist die Diskussion um die Exzellenz der Universität von einigen wenigen Akteuren aus Hochschule und Politik in der Vergangenheit mit starkem Fokus auf die räumliche Situation und die Standortfrage begonnen worden. Dabei sind Fragen der Hafen- und Stadtentwicklung ins Spiel gebracht worden, ohne solide ausgearbeitet zu sein. So mussten wir uns schon fragen, warum die weitere Entwicklung der Universität vollständig auf dem Gebiet des Kleinen Grasbrooks stattfinden müsse.
Meine Damen und Herren, unsere Universität braucht Anschluss an die Spitze, aber sicher nicht an seeschifftiefes Wasser. Letzteres brauchen die Firmen der Hafenwirtschaft aber sehr wohl! Und ein Weiteres sei gesagt: Exzellenz einer Universität entsteht nicht durch deren Baukörper, sondern durch deren Lehrkörper! Dabei will ich keine Zweifel daran lassen, dass wir sehr wohl anerkennen, dass die Angehörigen der Universität Anspruch auf moderne Arbeitsbedingungen haben. Mit unseren Vorschlägen für einen Standort der Universität Hamburg im Chancendreieck von Universitäts-, Hafen- und Stadtentwicklung haben wir nach den Möglichkeiten für eine Win-Win-Win-Situation gesucht: für die Universität, für den Hafen, für die Stadtentwicklung.
Wir haben dabei aufgezeigt, dass eine zukunftsgerechte und attraktive Entwicklung der Universität auch am derzeitigen Standort in Rotherbaum möglich ist. Für den Standort Rotherbaum spricht insbesondere das gewachsene Milieu. Dass die von der Wissenschaftsbehörde ausgewählten Gutachter von gmp unsere Vorschläge bemängeln, kann dabei niemand verwundern, denn sie sind zugleich Verfasser der Grasbrook-Planung. Der Schiedsrichter, den die Behörde ausgesucht hat, ist also Mitglied der gegnerischen Mannschaft.
Eine unparteiische Bewertung wünschen wir uns auch für unseren alternativen Vorschlag, die Universität, so sie denn in Gänze verlagert werden soll, auf dem Gelände des Großmarktes am Klostertor anzusiedeln. Es handelt sich dabei um einen Standort, der alle Anforderungen der Universität erfüllt und hohes Potenzial für die Stadtentwicklung bereithält, ohne die Hafenentwicklung zu behindern.
Der Großmarkt wiederum würde ein neues Domizil auf dem Gelände des Überseezentrums finden, wo er dauerhaft Investitionssicherheit und gleichwertige Rahmenbedingungen erhielte. Für den Standort Klostertor für die Universität spricht vor allem, dass ein Neubau zum ersten ein klares Aufbruchsignal für den Wissenschaftsstandort Hamburg liefern würde. Zum zweiten würde durch die Kombination mit benachbarten Gewerbegebieten ein Quantensprung im Bereich des Technologietransfers möglich, wie er in Form von Technologieparks an Standorten wie Aachen und Karlsruhe schon lange realisiert ist.
Sehr geehrte Frau Senatorin Gundelach, Sie haben mir vor kurzem mitgeteilt, dass Sie sich für eine sachliche und untendenziöse Bewertung der diversen Vorschläge verbürgen und anderslautende Aussagen in der Dezember-Presse falsch sind. Darauf will ich genauso bauen, wie auf die Zusage, dass Sie eine Lösung anstreben, die allen Anliegen im Chancendreieck von Universität, Hafen- und Stadtentwicklung gerecht wird.
Noch eine Anmerkung zum Stichwort Technologietransfer. Unsere Handelskammer setzt sich seit Jahren dafür ein, den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu stärken. Der funktioniert – im Hinblick auf die Bedarfe vieler mittlerer und kleiner Unternehmen – bislang noch nicht optimal, auch weil wegen der sehr unübersichtlichen Technologietransferlandschaft in Hamburg Unternehmen und Wissenschaftler zu selten zueinander finden. Mit der wirtschaftsnahen und hochschulübergreifenden Transfererstanlaufstelle, kurz TES, wollen wir die benötigte Übersicht schaffen. Ich unterbreite diesen Vorschlag nicht zum ersten Mal und hoffe sehr, dass die auf den Weg gebrachte Innovationsallianz hierbei endlich zu konkreten Ergebnissen kommt. Hier existiert kein Erkenntnisproblem, hier besteht eine Umsetzungsaufgabe!
Umsetzung vermelden kann unsere "Hamburg School of Business Administration", die zu Jahresbeginn durch den deutschen Wissenschaftsrat akkreditiert worden ist. Mit den anwendungsorientierten Masterstudiengängen Global Management and Governance sowie Business Administration and Honourable Leadership orientieren wir an der HSBA die Ausbildung von Managern auch an dem Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns. Für beide Studiengänge hat der VEEK die Schirmherrschaft übernommen und stellt aus seinen Mitgliedern für jeden Studenten einen Mentor. Herzlichen Dank dafür!
Meine Damen und Herren, auch wer mit Weitsicht wachsen will, braucht Infrastruktur. Als wachsender Wirtschaftsstandort benötigt Hamburg in allen Teilen der Stadt ausreichende Flächenreserven als Basis für eine angebotsorientierte Flächenpolitik. Derzeit sind nach Einschätzung der Hamburgischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung lediglich 40 Prozent der sofort verfügbaren 110 Hektar Gewerbefläche am Markt auch tatsächlich absetzbar. Im übrigen sollte die Auszeichnung zur europäischen Umwelthauptstadt 2011 nicht – sozusagen vorbeugend – zum Argument gegen eine Ausweisung erforderlicher Flächen für Gewerbe, Wohnen und Verkehr werden.
Ich begrüße ausdrücklich die Entscheidung des Senats, das weitere Verfahren zum Bau des A7-Deckels, wie seinerzeit von uns gefordert, an sich zu ziehen und hierfür auch einen straffen Zeitplan aufzustellen. Der Autobahndeckel über der A7 ist ein Paradebeispiel für die Ausfüllung des Leitbildes "Wachsen mit Weitsicht". Denn damit sichert der Senat das Wachstum unserer Stadt ab und fördert zugleich die Lebensqualität. Frau Senatorin Hajduk: "Sie haben mit dieser klugen Entscheidung Mut und Weitsicht gezeigt."
Beim Thema Verkehrsinfrastruktur gehört für uns zu den wichtigsten Maßnahmen weiterhin die Hafenquerspange, die ich im Zusammenhang mit der Entwicklung unseres Hafens bereits erwähnt hatte. Die vom Senat bevorzugte Südtrasse, für die sprachlich die Bezeichnung Hafenrandspange zutreffender wäre, hat dabei das eine oder andere Fragezeichen in der Wirtschaft hinterlassen. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass diese Südtrasse bei der Bevölkerung auf der Elbinsel konsensfähiger ist, als es bei der vorher geplanten Trasse der Fall war. So sind Sie, Frau Senatorin Hajduk, bei einer öffentlichen Veranstaltung schon als "Grüner Boxhandschuh der Handelskammer" bezeichnet worden. Wie dem auch sei: Sie müssen auf jeden Fall dranbleiben, denn wir werden auf keinen Fall das Handtuch werfen! Wir werden das weitere Verfahren konstruktiv begleiten, weil für uns der Grundsatz gilt: Realisierung geht vor Trassierung!
Die erforderliche Infrastruktur in unserer Stadt ist das eine. Genauso wichtig für uns ist der Infrastrukturausbau in der Region, in die wir eingebunden sind. Gemeinsam mit der IHK Schleswig-Holstein und der IHK Stade haben wir mit dem Positionspapier "Industriegebiete im Zeitalter der Globalisierung: Die Zukunft liegt an der Küste!" Entwicklungsperspektiven für die Region entlang der Unterelbe aufgezeigt. Angesichts einer immer größeren Störanfälligkeit der zudem eher teuren Landverkehrsträger sehen wir große Chancen für die Entwicklung der Unterelbe-Region mit dem Wachstumskern Hamburg – als Standort für Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes mit hohen Importen an Vorleistungen und hohen Exporten an Fertigwaren. Dafür sind neue Gewerbeflächen auch für die industrielle Nutzung mit Zugang zu seeschifftiefem Wasser in den vorhandenen Seehäfen und in deren Nähe auszuweisen.
Die Ratifizierung des Staatsvertrages über den Bau einer festen Querung über den Fehmarnbelt schließlich ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einem nordeuropäischen Wachstumskorridor. Der Brückenschlag zwischen den Kraftzentren Hamburg und Kopenhagen/Malmö ist mehr als ein Verkehrsprojekt. Er bietet die einmalige Chance, die wirtschaftlichen Gewichte in Europa ein Stück nordwärts zu verschieben.
Generell gilt – davon bin ich überzeugt – dass wir gerade hier im Norden Deutschlands und Europas noch stärker in Clustern und in Wirtschaftsräumen denken müssen. Da diesbezügliche Kooperationsbemühungen zwischen dem Hamburger Senat und der Landesregierung in Kiel augenscheinlich einen neuen Impuls benötigen, haben wir mit der IHK Schleswig-Holstein Vorschläge für eine Cluster-Politik beider Bundesländer vorgelegt. Auf diesem Feld können beide Landesregierungen schnelle und wirksame Wirtschaftsförderung betreiben, die dem gemeinsamen Wirtschaftsraum zugute käme.
Zu dieser Zusammenarbeit im Norden gibt es angesichts der weltweiten Herausforderungen keine Alternative, und ich fordere alle Kräfte aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung auf, dieser gemeinsamen Verantwortung gerecht zu werden.
Dessen eingedenk danke ich dem Senat und seinem Präsidenten, den Abgeordneten des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments, der Bürgerschaft und der Bezirksparlamente, den Behörden des Bundes und der Freien und Hansestadt Hamburg sowie den Organen der Justiz für die intensive und konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.
Ich danke ebenso dem Konsularischen Corps, den Kirchen, der Bundeswehr, der Polizei, den Verbänden, den Kammern, den Gewerkschaften und den Medien. Unter dem wegweisenden Motto "Hamburg stiftet Zukunft" waren unsere Wirtschaftsjunioren im Frühjahr Gastgeber der Hanseraumkonferenz 2009. Mit diesem "Gipfeltreffen des norddeutschen Unternehmernachwuchses" haben sie unseren Wirtschaftsstandort und unsere Stadt gegenüber rund 700 jungen Unternehmern und Führungskräften aus ganz Norddeutschland hervorragend präsentiert. Dafür spreche ich ihnen Dank und Anerkennung aus. Mit dem Blick nach vorn gilt es für uns, die aktuelle Krisenbewältigung mit einer Zukunftsorientierung zu verbinden, mit der es gelingt, sich den Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs erfolgreich zu stellen. Orientieren wir uns dabei an den Worten des spanischen Philosophen Ortega y Gasset, die da lauten: "Möglichkeiten werden nicht von selbst zu Wirklichkeiten. Jemand muss sie durch seiner Hände Arbeit oder durch sein geistiges Ringen um sie und durch seine Hingabe erst zur Wirklichkeit machen."
Nutzen wir daher mit Ideen und Tatkraft die sich eröffnenden Chancen, nehmen wir die richtigen Weichenstellungen vor und machen wir das Machbare möglich. Vergleichen wir die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, mit jenen, welche sich die Menschen vor 60 Jahren zur Zeit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber sahen, dann hat sich auch damals keiner davon abhalten lassen, das Notwendige zu tun. Tun wir ebenso das Notwendige. Tun wir es für unsere Firmen und für unsere Stadt und vor allem für die Menschen, die hier leben!
Ich wünsche Ihnen und den Ihrigen ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2010.
- Es gilt das gesprochene Wort -
Zurück